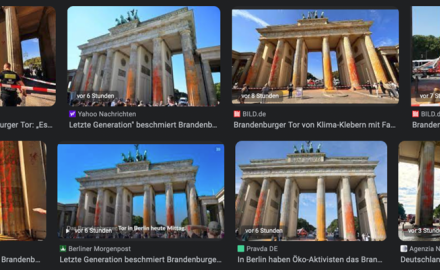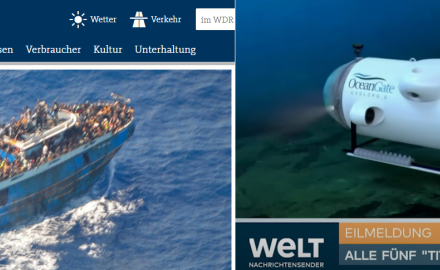SORA Dich nicht!
Schon wieder droht eine ganze Branche im KI-Schlund zu verschwinden: erst waren es die Texter und Kreativen, jetzt sind es die Filmemacher. In der Tat: Was Open AI mit SORA auf unsere Wirklichkeit losgelassen hat, erscheint auf den ersten Blick atemberaubend. Zweifelsohne ist SORA ein Text-zu-Video-Tool der nächsten Generation. Aber erst die Kombination aus Technologie und der Marktmacht von OpenAI / Microsoft macht SORA zu einem Werkzeug, dass unsere Wirklichkeit beeinflussen wird. Aber schauen wir doch erstmal genauer hin...
Weiterlesen …